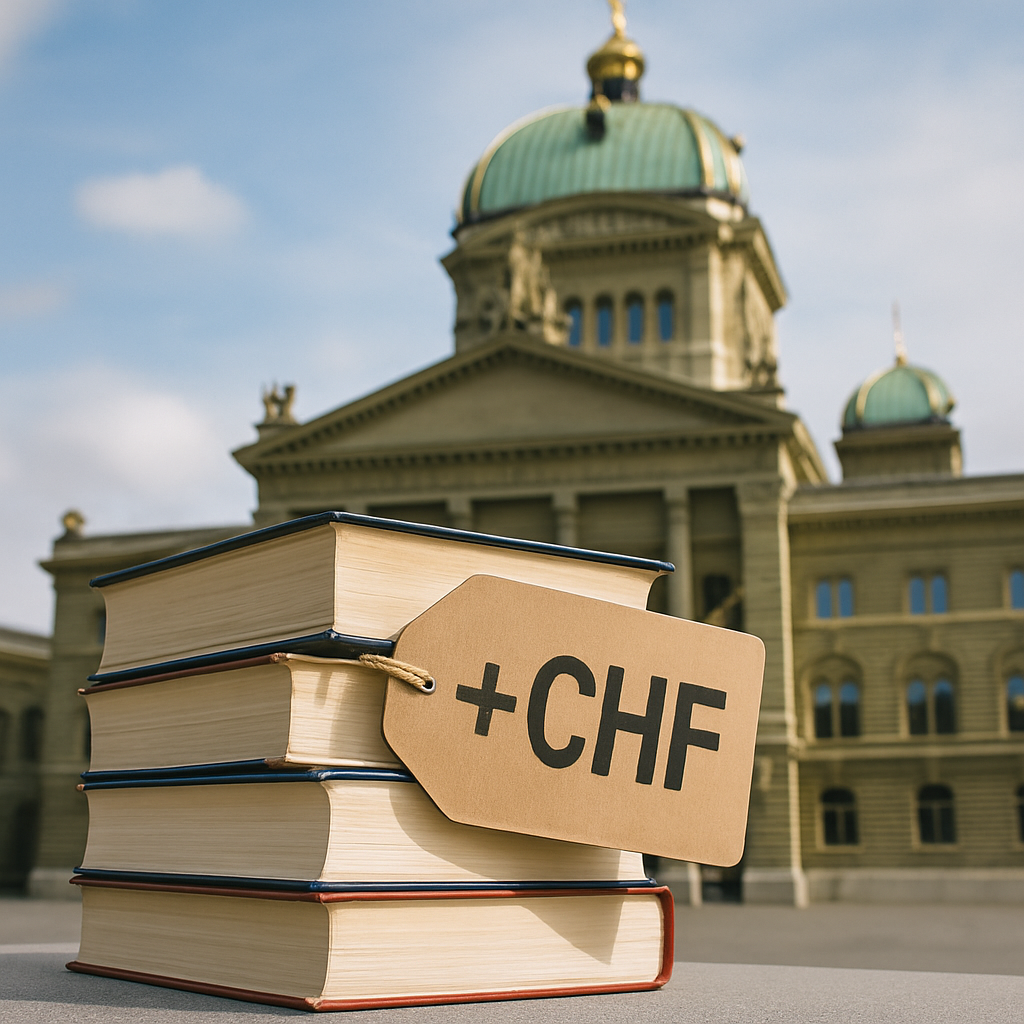Doppelte Gebühren – ungleiche Chancen
Studieren wird teurer, womöglich doppelt so teuer.
Der Bundesrat plant eine Verdopplung der Studiengebühren ab 2027. Für viele Studierende, die heute schon am finanziellen Limit leben, könnte das eine Belastung bedeuten – und die Chancengleichheit im Bildungssystem ernsthaft gefährden
Autorin: Siri Bavier
Titelbild: Der Bund will die Studiengebühren erhöhen: erstellt durch Chatgpt
Darum geht’s
• Ab 2027 sollen Studiengebühren verdoppelt werden, für ausländische Studierende sogar vervierfacht.
• Mehr Druck für Studierende: 72% der Studierenden in der Schweiz arbeiten neben dem Studium.
• 60% der Stipendiengesuche werden abgelehnt; kantonale Unterschiede erschweren den Zugang zusätzlich.
• Linke warnen vor wachsender Ungleichheit -Rechte verweisen auf internationale Vergleichswerte.
• Ausblick: Das Parlament entscheidet in den kommenden Monaten über die Gebührenerhöhung.
Steigende Mieten, Krankenkassenprämien und Lebenshaltungskosten setzen viele unter Druck – darunter auch Studierende, deren finanzielle Mittel oft begrenzt sind. Zugleich wird ein Studium zunehmend zur Voraussetzung für viele Berufe. Und es sind längst nicht mehr nur Gymnasialabgänger:innen, die den Weg an die Hochschulen wählen. Viele entscheiden sich später im Leben für ein Studium – etwa im Zuge eines Branchenwechsels oder eines Zweitstudiums. Das zeigt sich auch im Durchschnittsalter der Studierenden in der Schweiz, das laut Bundesamt für Statistik mittlerweile bei 26 Jahren liegt. Die Anzahl der Studierenden wächst und wird dadurch immer vielfältiger. Das bringt Herausforderungen mit sich: Wer studiert und gleichzeitig arbeitet, steht unter dem Druck, beiden Verpflichtungen gerecht zu werden.
Nun soll es für die Studierenden noch schwieriger werden. Der Bundesrat hat Ende Januar ein Entlastungspaket in die Vernehmlassung geschickt und plant im Bildungsbereich 460 Millionen Franken einzusparen. So sollen ab dem Jahr 2027 die Studiengebühren verdoppelt werden. Diese fallen bei Studierenden zweimal jährlich für die Nutzung von Lehrangeboten und Infrastruktur an. Die Ankündigung sorgt für Unmut bei den Studierenden und Bildungsinstitutionen.
Wie der Dachverband swissuniversities berichtet, bezahlen Schweizer Studierende im Durchschnitt 1448 Franken pro Jahr bei ausländischen Studierenden sind es 2510 Franken. Der Bundesrat schlägt hier gar eine Vervierfachung der Gebühren vor.
Grafik: Siri Bavier Datenquelle: Volkswirtschaftliche Beratung AG
Studieren, schuften, sparen – drei Studierende erzählen
Laut dem Bundesamt für Statistik sind 72 Prozent aller Studierenden in der Schweiz erwerbstätig. Wie das Studium finanziert wird, korreliert stark mit dem Alter. Während die Unterstützung der Eltern bei jüngeren Studierenden (bis 25 Jahre) mehr als die Hälfte der Einnahmen ausmacht, decken ältere (ab 26 Jahren) ihre Ausgaben hauptsächlich mit Einnahmen aus eigener Erwerbstätigkeit.
Susi G. 25, studiert Wirtschaftsrecht im 4. Semester
„Ich studiere von Montag bis Freitag und arbeite am Wochenende. Wie ich die Erhöhung der Studiengebühren tragen soll, das wüsste ich aktuell nicht.» Susi studiert Wirtschaftsrecht im 4. Semester und finanziert ihr Studium selbst. Unter der Woche besucht sie Vorlesungen, an den Wochenenden arbeitet sie in einer Bar. Für Freizeit, Erholung oder Freunde bleibt kaum Zeit.
Bild: Susi G.
Grafik: Siri Bavier
Zwar stammt sie nicht aus einer einkommensschwachen Familie, doch da auch ihre beiden Geschwister studieren, ist es ihren Eltern nicht möglich, die Kosten aller Kinder vollumfänglich zu tragen. Sie hatte ein Stipendium beantragt, doch es wurde aufgrund des Eigenheims ihrer Eltern abgelehnt, obwohl die Familie realistisch gesehen nicht in der Lage ist, alle Kosten zu tragen.
«Ich will mit 25 nicht auf der Tasche meiner Eltern liegen.»
Doch sich selbst zu finanzieren und zu studieren, sei anstrengend. „Ich hatte erste Anzeichen eines Burnouts – und ich bin nicht die Einzige.“ Für viele, die sich selbst finanzieren, ist es frustrierend zu sehen, dass andere sich ganz auf das Studium konzentrieren können.
«Niemand kann etwas dafür, ob man aus einer einkommensstarken oder -schwachen Familie stammt. Aber die Richtung des Bundesrats finde ich bedenklich. Es trifft wieder jene, die ohnehin jeden Franken dreimal umdrehen müssen. Das gefährdet die Chancengleichheit ernsthaft. Bald können nur noch jene studieren, deren Eltern genug verdienen. Das darf nicht Ziel einer fairen Bildungspolitik sein.»
Rony H. 30, absolviert ein Zweitstudium in Digital Business Management
«Ich kann mir das Studium nur leisten, weil ich zehn Jahre bei der Bank gearbeitet habe.»
Rony absolviert mit 30 Jahren ein Zweitstudium – ohne Nebenjob. Das ist möglich, weil er zuvor in einer gut bezahlten Bankposition tätig war und sich bewusst ein finanzielles Polster aufgebaut hat. Dennoch war die Entscheidung für den Neustart kein einfacher Schritt.
«Es hat mich viel Mut gekostet, mein sicheres Einkommen aufzugeben. Ich musste mich klar dafür entscheiden, gewisse Bedingungen zu akzeptieren.» Dazu gehört: Zurück ins Elternhaus zu ziehen, um keine Miete zu zahlen und vorerst auf ein eigenes Einkommen zu verzichten. Eine grosse Umstellung sowohl emotional als auch finanziell. Ein Stipendium wurde ihm wegen des Zweitstudiums nicht gewährt. «Ich hätte natürlich lieber meine eigene Wohnung. Aber ich wusste, dass ich diesen Weg nur gehen kann, wenn ich mein Budget strikt plane und Kompromisse eingehe.»
Wie anspruchsvoll es ist, Studium und Arbeit unter einen Hut zu bringen, zeigt Shannon Senn. Die 27-Jährige studiert im 4. Semester Kommunikation an der ZHAW und arbeitet als stellvertretende Filialleiterin bei Denner. Ihr Arbeitstag beginnt früh morgens und endet oft erst gegen 19 Uhr, danach widmet sie sich ihrem Studium.
Im Video gewährt Shannon Einblick in ihren Alltag zwischen Berufsverantwortung und Studienverpflichtungen und zeigt, wie sie versucht, beiden gerecht zu werden.
Streit um faire Bildung
Die geplante Verdoppelung der Studiengebühren ab 2027 im Rahmen des Entlastungspakets des Bundes sorgt schweizweit für Kritik. Studierendenvertretungen, Hochschulen und politische Akteure warnen davor, dass der Zugang zur Bildung zunehmend vom Einkommen abhängig wird und damit die Chancengleichheit gefährdet ist. Besonders Studierende, die aus weniger privilegierten Verhältnissen stammen, könnten unter der zusätzlichen Belastung leiden oder müssen gar in Erwägung ziehen, ihr Studium abzubrechen.
Befürworter hingegen, etwa Vertreter der FDP oder der Jungfreisinnigen, argumentieren, dass im internationalen Vergleich in der Schweiz noch immer geringe Studiengebühren verlangt werden. Es sei legitim, dass Studierende sich stärker an den Kosten beteiligen, da sie später vom Studium profitieren. Gleichzeitig fordern sie jedoch begleitende Massnahmen, um Härtefälle abzufedern.
Die Vernehmlassung zu den Vorschlägen läuft derzeit noch. In den kommenden Monaten wird das Parlament darüber beraten, ob und in welchem Ausmass die Gebühren tatsächlich steigen sollen.
Stipendien in der Schweiz: Wie das System Fehlanreize setzt und den Zugang erschwert
Stipendien sollen Studierenden finanzielle Sicherheit bieten, doch das stark föderalistische System der Schweiz sorgt für Ungleichheit: Mehr als die Hälfte der Anträge wird abgelehnt. Ein Widerspruch in einem Land, das über Fachkräftemangel klagt.
Der Weg an die Hochschule wird für Studierende, die ihr Studium selbst finanzieren müssen, immer schwieriger. Während 2004 noch 13 Prozent der Personen in einer nachobligatorischen Ausbildung ein Stipendium bezogen, erhalten laut dem Bundesamt für Statistik im Jahr 2023 nur noch 7,2 Prozent eines. Kantonale Regelungen führen zu erheblichen Unterschieden bei der Vergabe und Höhe der Stipendien. Stipendien sollen Chancen schaffen, verstärken aber so bestehende Ungleichheiten.
Fast 60 Prozent der Studierenden, die in der Schweiz ein Stipendium beantragen, gehen laut dem Bundesamt für Statistik leer aus. Das durchschnittliche Stipendium liegt im Jahr 2023 in der Schweiz bei 759 Franken pro Monat. Ein Betrag, der ca. ein Drittel der Lebenshaltungskosten eines Studierenden deckt. Das föderalistische System der Schweiz sorgt jedoch für erhebliche kantonale Unterschiede: Während Studierende in Schaffhausen im Schnitt 477 Franken erhalten, sind es im Waadtland 944 Franken.
So viel zahlen die Kantone durchschnittlich:
| Schweiz | 759 |
| Zürich | 839 |
| Bern | 838 |
| Luzern | 608 |
| Uri | 494 |
| Schwyz | 557 |
| Obwalden | 766 |
| Nidwalden | 798 |
| Glarus | 673 |
| Zug | 774 |
| Freiburg | 678 |
| Solothurn | 700 |
| Basel-Stadt | 652 |
| Basel-Landschaft | 735 |
| Schaffhausen | 477 |
| Appenzell Ausserrhoden | 775 |
| Appenzell Innerrhoden | 538 |
| St. Gallen | 617 |
| Graubünden | 597 |
| Aargau | 438 |
| Thurgau | 706 |
| Tessin | 965 |
| Waadt | 944 |
| Wallis | 563 |
| Neuenburg | 659 |
| Genf | 931 |
| Jura | 741 |
Tabelle: Siri Bavier Berechnung der monatlichen Kosten auf Basis des Bundesamt für Statistik
Erschwerte Voraussetzungen: Die Anforderungen an Studierende am Beispiel Zürich
Wie komplex die Voraussetzungen für ein Stipendium sein können, zeigt sich am Beispiel von Zürich: Vollzeitstudierende ab 25 Jahren müssen eine Eigenleistung zwischen min. 3’000 und max. 20’000 Franken pro Jahr erbringen. Bei Teilzeitstudierenden erhöht sich der maximale Betrag der Eigenleistung auf 36’000 Franken.
Doch hier entsteht ein Dilemma: Studierende müssen genug arbeiten, um die geforderte Eigenleistung zu erreichen. Wer jedoch zu viel arbeitet, riskiert, dass das Stipendium gekürzt oder sogar zurückgefordert wird. Das System schafft damit Fehlanreize: Studierende, die versuchen, sich durch Mehrarbeit finanziell abzusichern, werden so bestraft.
So werden aus Studierenden Schuldner:innen. Wie das SRF-Format «Kassensturz» berichtet, musste eine Biologiestudentin aus dem Kanton Solothurn fast 20’000 Franken an Stipendien zurückzahlen. Während ihres Studiums arbeitete sie zusätzlich, um ihre Lebenshaltungskosten zu decken, ohne zu wissen, dass ihr Einkommen die zulässige Grenze überschritt. Erst nach Abschluss ihres Studiums erhielt sie die Nachricht vom Kanton, dass sie die erhaltenen Stipendien zurückzahlen muss. Eine gesetzliche Grundlage für solche Rückforderungen gibt es in den meisten Kantonen. Für die Studentin wurde die finanzielle Unterstützung so zur Schuldenfalle.
Dieser Fall ist kein Einzelfall: Laut dem letzten Bericht des Bundesamts für Statistik von 2020 sind schweizweit rund 10 Prozent der Studierenden verschuldet. Mehr als die Hälfte ganze 61 Prozent der Studierenden geben an, finanzielle Schwierigkeiten zu haben, während 13 Prozent sogar grosse bis sehr grosse Schwierigkeiten erwähnen.
Neben den Voraussetzungen für den Bezug eines Stipendiums kommen bürokratische Hindernisse hinzu. Jedes Jahr müssen Studierende ihr Gesuch neu einreichen, dabei haben manche Kantone Wartefristen bis zu sieben Monaten.
Für viele Studierende wird der finanzielle Druck zu gross: Laut einem Bericht des Schweizer Bildungsmagazins eduwo.ch geben 16 Prozent der Studierenden an, ihr Studium aufgrund finanzieller Schwierigkeiten abbrechen zu müssen. Dies verdeutlicht, wie entscheidend eine ausreichende finanzielle Unterstützung für den Studienerfolg ist.